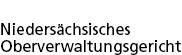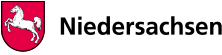Kirchliches Hausverbot wegen Störungen des Gottesdienstes
Das von einer Kirchengemeinde gegenüber einem Kirchenmitglied wegen einer Störung des Gottesdienstes ausgesprochene und auf kirchenrechtliche Bestimmungen gestützte Hausverbot unterliegt nicht der Kontrolle staatlicher Gerichte. Dies hat der 13. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts im Rahmen eines Eilverfahrens mit Beschluss vom 20. April 2010 - 13 ME 37/10 - entschieden und damit einen vorangegangenen Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts Braunschweig vom 17. Februar 2010 - 6 B 342/09 - bestätigt. Die Antragstellerin hat aus Sicht der Kirchengemeinde Gottesdienste nicht zu deren eigentlichen Zweck aufgesucht, sondern um persönlichen Kontakt zu einem bestimmten Pfarrer herzustellen, der sich - wie auch andere Gottesdienstteilnehmer - dadurch und durch bestimmte ungebührliche Verhaltensweisen belästigt sah. Die Kirchengemeinde hat unter Zugrundelegung des katholischen Kirchenrechts - des Codex Iuris Canonici - gegenüber der Antragstellerin ein Hausverbot ausgesprochen, nachdem Verständigungsversuche gescheitert waren. Nach Auffassung des Senats ist die Kirche dabei nur im Bereich ihrer innerkirchlichen Angelegenheiten tätig geworden. Nach dem kirchenpolitischen System des Grundgesetzes (vgl. Art. 140 des Grundgesetzes i.V.m. Art. 137 Abs. 1 und Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung) ordnet und verwaltet jede Religionsgemeinschaft ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Damit erkennt der Staat die Kirchen als Institutionen mit dem Recht der Selbstbestimmung an, die ihrem Wesen nach unabhängig vom Staat sind und ihre Gewalt nicht von ihm herleiten. Wird im Rahmen des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts eine Maßnahme wie das vorliegend angegriffene Hausverbot ergriffen, liegt kein Akt der öffentlichen Gewalt vor, der einer verwaltungsgerichtlichen Kontrolle zugänglich wäre.